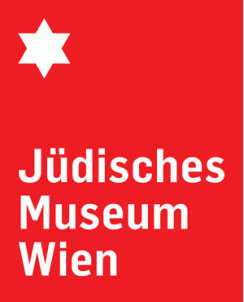Kultur und Weindas beschauliche MagazinSag mir, wo die Blumen sind, Ausstellungsansicht SAG MIR, WO DIE BLUMEN SIND... Aktuelle Fotos zum schuldigen Erinnern
Zum guten Teil sind es touristische Hotspots, wo noch vor gut 80 Jahren unvorstellbare Gräuel stattgefunden haben. Mit kindischer Lust wird von den Reenactors Krieg gespielt, die Todesstraße ins Vernichtungslager wird zur entspannenden Promenade und wo Kinder als Flak-Helfer missbraucht wurden, gibt es heute fröhliche Fußballmatches. Mit diesen Gegensätzen spielen die Fotos, mit denen der niederländische Fotograf Roger Cremers seit 2008 sogenannte „Orte der Erinnerung“ aus dem Zweiten Weltkrieg und den KZ der Nazis dokumentiert. Es geht ihm dabei um die gegenwärtige Aneignung durch eine Gesellschaft, die sich erstaunlich befreit fühlt, wenn die Schuldfrage am „Damals“ aufgeworfen wird. Als hätten die mittlerweile vergangenen Jahrzehnte eine undurchdringliche Wand zwischen den einstigen „Tätern“ und den Nachgeborenen aufgebaut, errichtet aus Verschweigen und Vergessen, so fern erscheinen uns diese menschlichen Katastrophen, trotz eines mantraartig wiederholten „Nie wieder!“ und feierlichen Kranzniederlegungen bei Soldatenfriedhöfen oder bewegten Reden vor Mahnmalen der Vernichtung.
Wenn Cremers in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau den gesteckt vollen Shuttlebus vom „Stammlager“ zum „Konzentrations- und Vernichtungslager“ zeigt, drängt sich unwillkürlich die Assoziation zu den Transporten ausgemergelter Häftlinge zu den Gaskammern Anfang 1945 auf. Ob sich die gut genährten Leute in ihrer Freizeitkleidung dessen bewusst sind? Es sind noch viel mehr Fragen, die von jedem einzelnen Foto aufgeworfen werden. Man muss nur genau hinschauen und die Details wahrnehmen, die sich im Bildhintergrund verstecken oder hinter dem offensiv zur Schau getragenen Spaß an den präsentierten Attraktionen des Schreckens.
Aufgrund eines Auftrages des Jüdischen Museums Wien hat Roger Cremers 2024 auch in Österreich fotografiert. Er besuchte dazu die KZ-Gedenkstätten Mauthausen, Gusen und Melk, die Euthanasie-Gedenkstätte Schloss Hartheim und etliche Plätze in Wien. Damit rückt die Thematik spürbar näher an die eigene Haut. Doch was hilft das alles, wenn die Zeichen der Zeit dagegen stehen? Es sind nicht unbedingt die Falschen, die sich schuldbewusst auf die Brust klopfen. Aber sie sind offenbar zu wenige, sie sind zu leise, zu schwach, um im gegenwärtigen Trend zu Hass, gegenseitiger Ablehnung und krausen Verschwörungstheorien wahrgenommen zu werden. „Sag mir, wo die Blumen sind“ wurde 1955 von Pete Seeger geschaffen. Es wurde dank Marlene Dietrich und Hildegard Knef zu einem berührenden Schlager, der nun als Titel dieser Ausstellung am Judenplatz bis 18. Jänner 2026 zum Nachdenken einlädt – und nicht zuletzt zu einer angesichts derzeitig bedenklichen Geschehens ernüchternden Antwort auf die Textzeile „Wann wird man je versteh´n?“ führt. „Nie!“ Statistik |