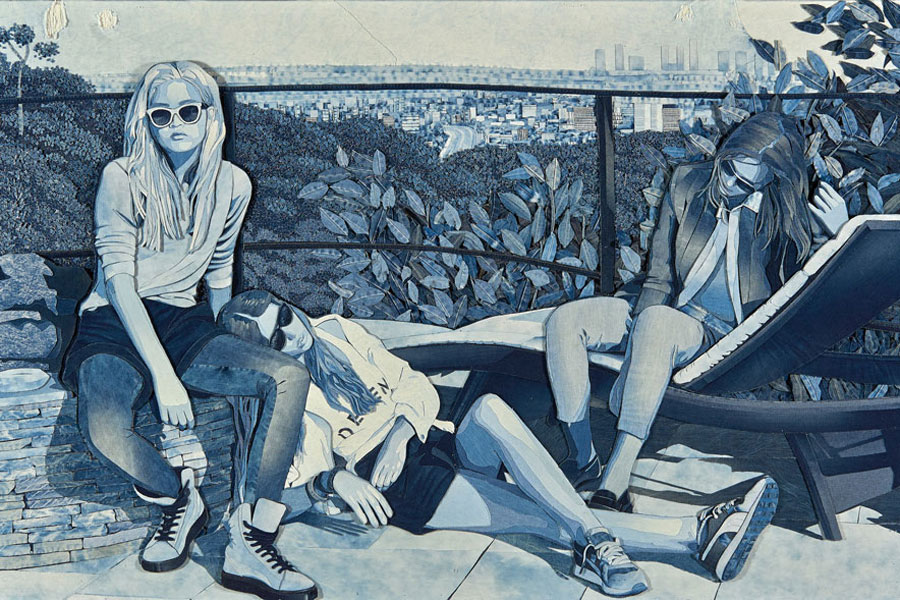Kultur und Weindas beschauliche MagazinDie Farben der Erde, Ausstellungsansicht © KHM-Museumsverband, Weltmuseum Wien, Foto: Daniel Sostaric DIE FARBEN DER ERDE Indigene Textilkunst aus Mexiko
Die Frauen sitzen an einfachen Webrahmen, wie sie schon von ihren Urahninnen zur Herstellung ihrer Textilien verwendet wurden. Die Kettfäden aus Baumwolle sind zumeist hell. Die Farbe bringt der Schuss, teils hochkompliziert gefertigt, der von Hand eingeführt wird. Das Endprodukt ist eine Textilie, deren Muster über die äußerliche Ästhetik hinaus immer wieder mythologische Geschichten ihres Volkes, der Mayas, erzählen. Von Generation zu Generation wurde dieses Wissen, vereint mit der Technik weitergegeben. Dazu zählt auch die Herstellung der Farben. Sie finden sich in der Natur Mexikos und werden aus Eichenblättern, dem Brasilholz, der Studentenblume oder sogar aus dem schwarzen Schlamm gewonnen. So entstandenen Werke und deren Schöpferinnen sind nun bis 6. April 2026 im Weltmuseum Wien unter dem Titel „Die Farben der Erde. Moderne Textilkunst in Meiko“ zu bewundern.
Möglich wurde diese Ausstellung durch das Engagement des mexikanischen Künstlers Carlos Barrera Reyes (*1978). Seine Werke zeichnen sich durch eine intensive Auseinandersetzung mit verschiedensten Materialien und Formaten aus. Er hat diese Weberinnen besucht und sie bei der Arbeit beobachtet und gefilmt. Reyes wurde dabei vom Bedürfnis erfüllt, das dabei gewonnene Wissen weiterzugeben und damit einen Beitrag zur Erhaltung dieses kunstvollen Gewerbes zu liefern. Dabei wurde darin auch eine Neubelebung in einem zeitgenössischen Kontext entdeckt; deswegen der irritierende Ausdruck „modern“ im Titel. So ist neben traditionellen Geweben sogar einem zeremoniellen Kleidungsstück, dem Huipil, ein Platz im 21. Jahrhunderts eingeräumt.
Kolonialismus am Fensterbrett, Ausstellungsansicht KOLONIALISMUS AM FENSTERBRETT Liebgewonnene botanische Immigranten
Zimmerpflanzen sind allgemein beliebte Gesprächspartner. Wenn sie selbst auch schweigen, sind sie doch dankbare Zuhörer, die sich für derlei Zuwendung mit angeblich üppigem Wachstum und prächtigen Blüten revanchieren. Im Weltmuseum werden die Rollen nun in der Ausstellung „Kolonialismus am Fensterbrett“ (bis 25. Mai 2026) getauscht. Lebende Vertreter unserer beliebtesten Zimmer- und Balkonpflanzen wurden dafür mit anschaulichem Informationsmaterial wie historischen Objekten, Fotografien oder Seiten aus Herbarien kombiniert. Damit sind Dieffenbachie, Grünlilie und Usambaraveilchen in der Lage, uns über ihre eigentliche Heimat, das nicht immer freundliche Schicksal ihrer Verpflanzung in unsere Breiten und eine teils rücksichtslose Nutzung z. B. durch Pharmakonzerne zu erzählen.
Die systematische Suche nach Heil- und Nutzpflanzen, den Cash crops, begann im 18. Jahrhundert. Zuerst wurden nur Samen, Zwiebeln und Rhizome über die Weltmeere verschifft. James Cook war bei seiner zweiten Weltumseglung 1774 bereits in der Lage, die Zimmer- oder Norfolktanne aus dem Südpazifik lebend mit nachhause zu bringen. Ihm imponierte der gerade Wuchs, der sich für Schiffsmasten hervorragend eignete. Dass dieser immergrüne Baum in seiner Heimat, den Norfolkinseln, stattliche 50 bis 70 Meter hoch werden kann, ist seinen Nachkommen in unseren Gewächshäusern oder Wohnzimmern nur schwer abzunehmen.
Wer hat die Hosen an? Ausstellungsansicht © KHM-Museumsverband, Foto: Daniel Sostaric WER HAT DIE HOSEN AN? Beinkleider aller Zeiten für ihn und sie
Noble Römer, gewickelt in die festliche Toga, konnten über die seltsame Tracht ihrer barbarischen Nachbarn nur die Nase rümpfen. Da trugen diese wilden Reiter doch bei ihren Angriffen auf das Imperium Schläuche über ihren Beinen, geradeso wie von den Griechen berichtet die mythischen Amazonen, diese rasenden Weiber, die ganze Heere in Angst und Schrecken versetzen konnten. Heute ist es unvorstellbar, dass eine Hochkultur über Jahrhunderte ohne die Hose ausgekommen ist; also mit den außen getragenen Beinkleidern, aber auch mit denen darunter, den Unaussprechlichen, die erst in jüngerer Zeit die intimen Bereiche schützend und wärmend bedecken. Lange galt dafür die maskuline Forderung, dass er die Hosen anhaben müsse, um in einer Zweierbeziehung als Mann zu gelten. Mittlerweile haben auch die Frauen erkannt, dass die Hose, egal ob als eleganter Unterteil eines Kostüms oder als figurunabhängige Leggings, die bequemere Kleidung für vielerlei Gelegenheiten darstellt.
So ist die Frage „Wer hat die Hosen an?“ durchaus berechtigt. Das Kuratorinnenteam um die Textilrestauratorin Barbara Pöninghaus-Matuella hält sich bezüglich der Antwort heraus. Sie laden vielmehr zu einem Streifzug durch 3.000 Jahre Hosengeschichte aus aller Welt ein. Das älteste Exemplar stammt aus Turfan in Westchina und ist als Replik zu bewundern. Das nächstälteste Stück, eine Pluderhose aus Nubien (heute südliches Ägypten), ist aber tatsächlich gute 1000 Jahre alt. Dass auch die Kelten die Hosen schätzten, beweisen eine Gewandfibel aus der La Tène Kultur und Darstellungen auf antiken Münzen. Am Beginn der Ausstellung (bis 1. Februar 2026) steht allerdings Kunst der Gegenwart. Laura Eckert lässt einen aus Holzplättchen bestehenden nackten Mann eine Kerze turnen. Die verletzlich wirkende Plastik, vor allem der nach oben gestreckte Unterkörper, schreit förmlich nach Bekleidung. Angeboten werden dazu zehn Optionen aus Asien, Afrika und Amerika von arktisch bis subtropisch.
Man sieht, es fehlt nicht an unterhaltsamen Elementen, raffiniert verbunden mit sanfter Belehrung. Zum Schmunzeln ist die Skulptur „Trophy fort he Longest Pee“, geschaffen vom Isländer Guðmundur Thoroddsen als Preis für den weitesten Stehpinkler, und männliche Urängste weckend das Bild „Revenge of the Geisha Girl“ mit blutrotem Slip der japanischen Künstlerin Yūko Shimizu. Auf Bildern tritt mit uns den Hosenrollen aus Oper und Theater eine charmante Aneignung männlicher, besser, knabenhafter Darstellung durch schlanke junge Frauen entgegen. Von ihnen weg führt der Weg nun in den zweiten Teil, in dem Hingreifen ausdrücklich erwünscht ist.
Statistik |